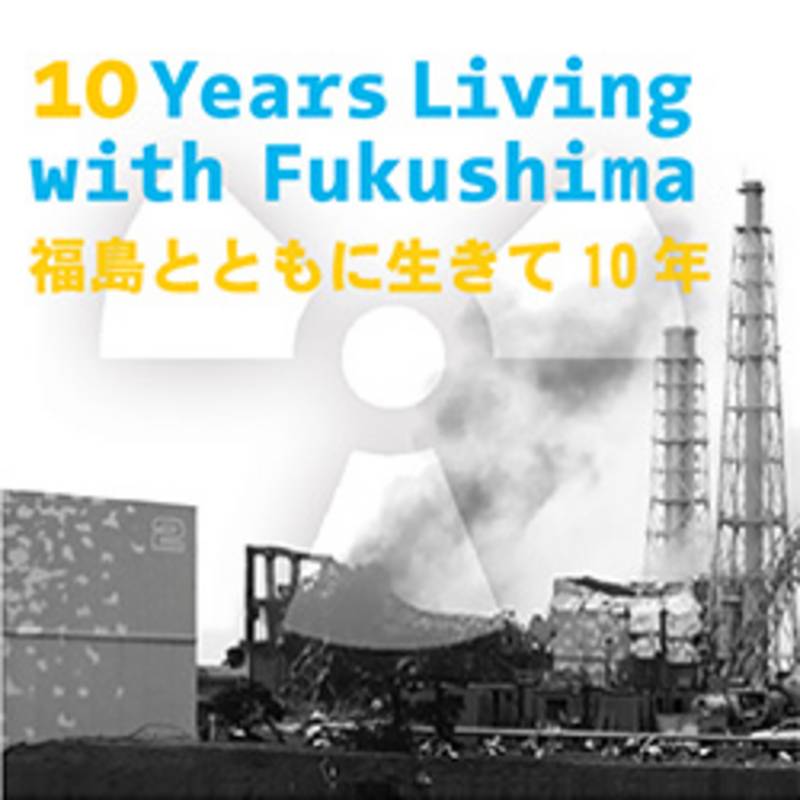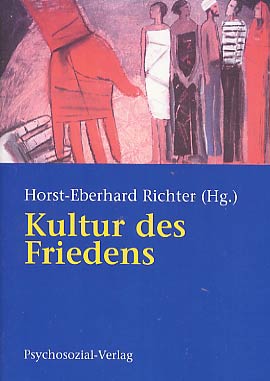Kongressreihe "Kultur des Friedens"
Im UNESCO-Jahr "Kultur des Friedens" 2000 etablierte IPPNW-Gründungsmitglied Horst-Eberhard Richter unter dem gleichen Namen eine Kongressreihe. Eine friedlichere und gerechtere Welt brauche mehr von einem Geist der Menschlichkeit, der alle Bereiche durchdringe, von der Kirche bis zum Völkerrecht, von der Ökonomie bis zu Kunst, von der Ökologie bis zur Pädagogik, vom Gesundheitswesen bis zur Naturwissenschaft und von den Medien bis zur Philosophie. In der Folge fanden in unregelmäßigen Abständen zwei weitere Kongresse unter dem Motto statt. Im Jahr 2015 - drei Jahre nach dem Tod von Richter- veranstaltete die IPPNW einen weiteren Friedenskongress in Frankfurt unter der Überschrift "Unser Rezept für Frieden: Prävention".
Jahrestagung "Für eine Kultur des Friedens" 2023
40-Jahre IPPNW

Die Jahrestagung "Für eine Kultur des Friedens" der Landsberger IPPNW-Regionalgruppe fand am 30. September 2023 mit über 120 Teilnehmer*innen in Landsberg am Lech statt. Verabschiedet wurde ein Memorandum zur “Kultur des Friedens”, das die Notwendigkeit unterstreicht, in einer Welt existentieller Gefahren einen Gegenentwurf vorzustellen, der auf Friedfertigkeit und auf die Bereitschaft baut, Konflikte im Sinne der Charta der Vereinten Nationen im Dialog und mit Diplomatie zu lösen. "Die Verhinderung eines Atomkrieges und die Lösung der Klimakrise haben dabei höchste Priorität. Rüstungskontrolle, Abrüstung und Entspannung sind auch zukünftig eine zentrale Aufgabe der UN und deren Mitgliedsstaaten", so Andreas Zumach, Journalist und ehem. UN-Korrespondent in Genf, auf der Tagung in Landsberg.
Weitere Infos
Unser Rezept für Frieden: Prävention
Friedenskongress 2015

In einer Abschlusserklärung zur IPPNW-Konferenz "Unser Rezept für Frieden: Prävention" mit knapp 200 KonferenzteilnehmerInnen forderte die IPPNW von der Bundesregierung, gewaltlosen Konfliktlösungen endlich Vorrang einzuräumen vor militärischer Konfliktbearbeitung. Die Friedenskonferenz in Frankfurt befasste sich mit der Konfrontation zwischen Russland und der NATO, der Kette militärischer Konflikte von Syrien über den Irak und Afghanistan bis hin zum Drohnenkrieg in Pakistan – Konflikte, an denen die NATO und damit auch Deutschland direkt beteiligt sind. Die Referent*innen zeigten praktische Beispiele für eine auf Prävention angelegte Friedenskultur auf, von der Einrichtung eines Friedensministeriums über die Schaffung eines Mediationszentrums bis hin zur Unterstützung der Politiker*innen, die sich für Kooperation statt Konfrontation stark machen.
Zielscheibe Mensch
Internationaler Kongress zu den Folgen des Kleinwaffenhandels 2013

Mit Heckler & Koch ist einer der führenden Kleinwaffenhersteller Europas im schönen Schwarzwaldstädtchen Oberndorf am Neckar beheimatet. Die Waffen werden exportiert, wohin immer es geht. Nicht weit von Oberndorf, in Villingen-Schwenningen, fand vom 30. Mai bis 02. Juni 2013 der internationale Kongress zum Thema Kleinwaffen statt. Organisiert von der IPPNW in Zusammenarbeit mit der Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“ tauschten sich Expert*innen und Interessierte vieler Organisationen über die Auswirkungen dieser Waffen aus. Internationale Gäste z.B. aus Kenia, Iran, Nepal, und den USA brachten ihr Wissen und ihre Erfahrung ein. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops ging es um die sozialen und medizinischen Folgen des Einsatzes und Handels mit Kleinwaffen sowie um zukünftige Aktionen und Kampagnen zum Stopp der Rüstungsexporte.
„Friedenskultur.2010 - Unsere Zukunft atomwaffenfrei“
Kongress in Essen vom 19.-21. März 2010

In der Kulturhauptstadt Essen von 2010 veranstaltete die IPPNW gemeinsam mit DFG-VK, pax christi und dem Essener Friedensforum vom 19. - 21. März 2010 den in Essen den Kongress „Friedenskultur.2010 - Unsere Zukunft atomwaffenfrei“. Ziel war, das Bewusstsein für die Gefährdung einer gerechten und nachhaltigen Entwicklung durch die globale Militarisierung unter Einschluss der Drohung mit Atomwaffen zu fördern und zur Stärkung der Bewegungen beizutragen, die sich - lokal und global - für die Abschaffung aller Atomwaffen einsetzen. Der Kongress in der Volkshochschule Essen sollte den Menschen in der Ruhrregion und den bundesweiten und internationalen Besucher*innen die Gelegenheit bieten, sich über die komplexe Problematik des drohenden „Zweiten nuklearen Zeitalters“ kompetent zu informieren sowie die notwendigen Schritte und bestehenden Ansätze zur Abschaffung aller Atomwaffen zu diskutieren.
Kultur des Friedens - für eine solidarische Zukunft
Kongress "Kultur des Friedens" 2008

"Die Heilung zum Frieden braucht Impulse von unten", sagte der Psychoanalytiker und Buchautor Horst-Eberhard Richter auf der Abschlussveranstaltung des Kongresses "Kultur des Friedens" vom 12.-14. September 2008 in Berlin. Auf dem dreitägigen IPPNW-Kongress beschäftigten sich rund 700 Besucher*innen und 50 Referent*innen mit den globalen Bedrohungen der heutigen Zeit. Den Wettkampf um die Ressourcen als Kriegsursache thematisierten zahlreiche Veranstaltungen. Die Welt könne nur Frieden schaffen, wenn sie sich endlich von der Abhängigkeit der fossilen Ressourcen befreit, so der Tenor des Vortrages von Journalist und Publizist Andreas Zumach. "Bis ca. 2050 sollten wir lernen, etwa ein Fünftausendstel des Angebots der Sonne für dann 9 Milliarden Menschen für unsere Energieversorgung zu nützen", so Hartmut Graßl, ehemaliger Leiter des Weltklimaforschungsprogramms der UN.
Aufstehen für die Menschlichkeit
Kongress "Kultur des Friedens" 2003

Der von mehr als 1.000 Besucher*innen und 80 namhaften ReferentInnen aus dem In- und Ausland besuchte IPPNW-Kongress "Kultur des Friedens" vom 1.-4. Mai 2003 in Berlin resümierte über vier Tage den Irakkrieg und seine Einbettung in Globalisierung und militärische Neuordnungsbestrebungen der Welt. Beiträge und Debatten bestärkten die Forderung an die Politik, dass die Antwort Deutschlands und Europas auf die Gefahren kommender Kriege statt in weiterer Militarisierung und Aufrüstung vielmehr in einer resoluten Friedenspolitik mit festen Gewalt- und Kriegspräventionsstrukturen - z.B. verankert in der kommenden europäischen Verfassung - liegen müsse.
Kultur des Friedens
Berliner IPPNW-Kongress 2000

Eine Dekade nach dem Schwinden der unmittelbaren atomaren Bedrohung durch den Ost-West-Antagonismus und zu Beginn eines neuen Jahrtausends stellte die UNESCO das Jahr 2000 unter das Motto »Kultur des Friedens« – ein Motto, dessen sich auch die IPPNW angenommen hat. Sie veranstaltete im Dezember 2000 einen internationalen Kongress in Berlin, der als ein offizielles Projekt der UNESCO im Rahmen des UNESCO-Jahres stattfand. Die IPPNW – 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet – warben auf dem Kongress dafür, dass nur unter Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen eine bessere Friedenssicherung erreicht werden könne. Gerade angesichts neuerer Kriege in vielen Teilen der Erde erfordere eine Kultur des Friedens die Globalisierung der Erkenntnis, dass alle auf alle anderen in dieser Welt angewiesen sind – dass es also nur eine gemeinsame Sicherheit geben kann.
Kongressreihe "Medizin und Gewissen"
In fünfjährigem Abstand hat sich unter dem Motto „Medizin und Gewissen“ eine Kongressreihe der IPPNW etabliert, die in drei Themensträngen jeweils Fragen der Menschenrechte, Medizingeschichte und Ethik im Gesundheitswesen erörtert. Der Kongress zeichnet sich dadurch aus, neben renommierten Fachleuten auch besonders dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Plattform zu bieten. Mit dem Motto „50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess“ begann die Kongressreihe im Oktober 1996. Die Auseinandersetzung mit der Medizin im Nationalsozialismus gehörte damit von Anfang an zu den Säulen der Kongressreihe.
Medizin und Gewissen 2022
LebensWert
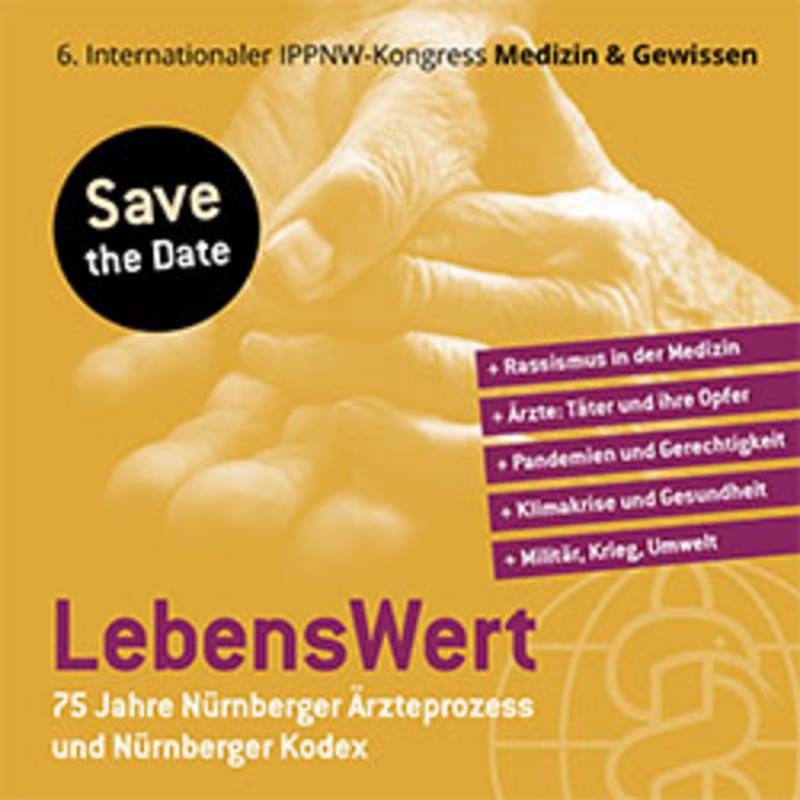
Der sechste Internationale Kongress „Medizin und Gewissen – LebensWert“ vom 21. bis 23. Oktober 2022 setzte die erfolgreiche Kongressreihe 1996, 2001, 2006, 2011 und 2016 fort. Jetzt, 75 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess und der Formulierung des Nürnberger Kodex, richteten wir den Blick auf unterschiedliche Aspekte des Themas „LebensWert“. Das Spannungsfeld zwischen historischer Verantwortung und künftigen Herausforderungen bot den Hintergrund für unsere drei Themenstränge: 1. Medizingeschichte: Neue Forschungen zum Ärzteprozess und Nürnberger Kodex – Deutsche Kolonialmedizin und ihre Auswirkungen bis heute – Alltäglicher und struktureller Rassismus im Gesundheitswesen – Geschichte der Pandemien, Bewältigungsstrategien damals und heute, 2. Planetary Health: Gesundheitskonzepte für Erde und Mensch – Klima-Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen – Klima und Militär und 3. Ethische Fragen im Medizinalltag: Global Health in und nach Zeiten der Pandemie – Kommerzialisierung der Medizin – Medizin für Heimatlose.
Thementagung Medizin und Gewissen 2021
Das Deutsche Rote Kreuz im Spannungsfeld zwischen humanitärem Anspruch und Realität 1914–1945
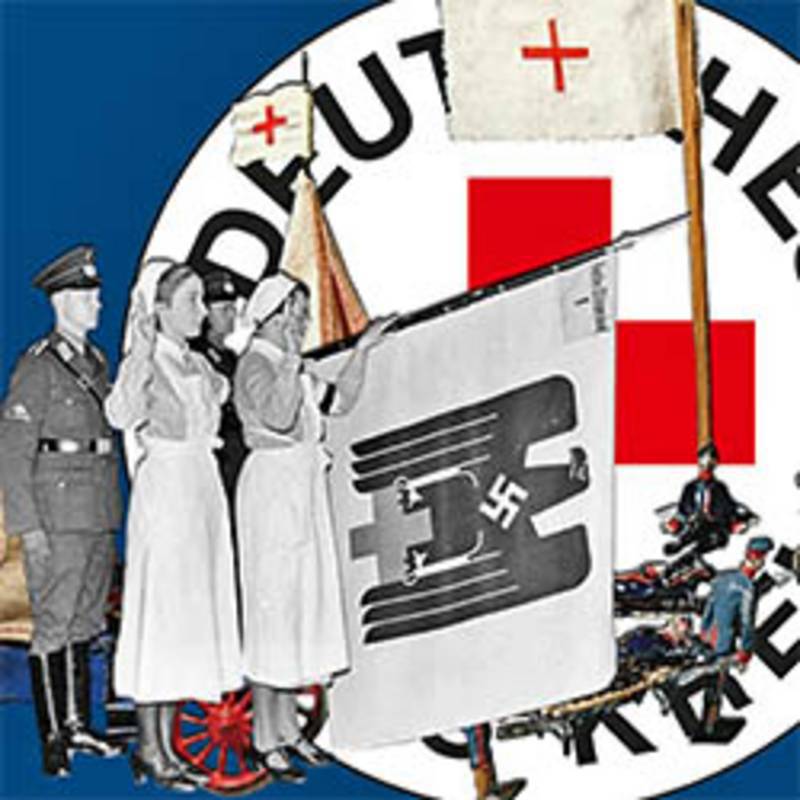
Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Deutschen Roten Kreuzes (offiziell gegründet am 25. Januar 1921 in Bamberg) organisierte die IPPNW eine medizinhistorisch-wissenschaftliche Online-Thementagung in Kooperation mit dem Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Das Deutsche Rote Kreuz hat seine aktive Verstrickung ins nationalsozialistische Unrechtsregime jahrzehntelang nicht nur aktiv negiert, sondern sich im Gegenteil als humanitäre Organisation in inhumanen Zeiten stilisiert. Zwar gibt es zaghafte Schritte innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes, diese Jahre historisch und ethisch genauer zu beleuchten, doch sie greifen zu kurz.
Thementagung Medizin und Gewissen 2019
Mit Vollgas in die Digitalisierung – wie kriegen wir die Kurve?

Außerhalb des gewohnten Fünf-Jahres-Rhythmus haben die deutsche IPPNW-Sektion und die Regionalgruppe Nürnberg-Fürth-Erlangen am 19. Oktober 2019 in Nürnberg eine themenzentrierte „Medizin und Gewissen“-Tagung organisiert. Aktuell wird die Digitalisierung mit rasanter Geschwindigkeit vorangetrieben: APPs, eGK, Big Data erfordern Umdenken. Für diese Digitalisierung braucht es einen ethischen Kompass – und damit fügte sich diese Tagung in die Kongress-Reihe ein, denn die ethischen Grundsätze bildeten auch bei den vorangegangenen fünf Kongressen den roten Faden. Dabei waren Akteure aus den Bereichen der IT-Sicherheit, eine große Krankenkasse, KV, Patientenvertretung, Forschung. Die 130 Teilnehmer*innen tauschten sich unter den unterschiedlichsten Blickwinkeln zur Digitalisierung im Gesundheitswesen aus.
Medizin und Gewissen 2016
Medizin, Macht und Moral

70 Jahre nach Beginn des Nürnberger Ärzteprozesses, nach den aktuellen Diskussionen um die Sterbehilfe und der filmischen Aufarbeitung der Euthanasie im Nationalsozialismus kam der 5. Internationale IPPNW-Kongress „Medizin und Gewissen – Was braucht der Mensch?“ genau zum richtigen Zeitpunkt. 400 Teilnehmer*innen und 40 Referent*innen beschäftigten sich in Nürnberg mit der Rolle von Ärzt*innen und insbesondere Psychiatern im Nationalsozialismus, mit ethischen Fragen im Medizinalltag und der Rolle von Menschen im Gesundheitswesen als Friedensstifter.
Medizin und Gewissen 2011
Gesundheitswesen – Menschenrechte – Medizingeschichte

Zum vierten Mal nach 1996, 2001 und 2006 fand am 14. und 15. Oktober 2011 in Erlangen der internationale Kongress „Medizin und Gewissen“ statt. Die Auseinandersetzung mit der Medizin im Nationalsozialismus wurde inhaltlich vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg organisiert. Als weitere Schwerpunkte gab es bei diesem Kongress die besondere Rolle der Gesundheitsberufe in Kontext internationaler Frieden- und Menschenrechtsarbeit – vorbereitet vom internationalen EU-Projekt „medical peace work“ – sowie die Rolle der Pharmazeutischen Industrie im deutschen Gesundheitswesen, vorbereitet vom Arbeitskreis „Medizin und Gewissen“ der Deutschen Sektion der IPPNW.
Medizin und Gewissen 2006
Zwischen Markt und Solidarität

Vom 20. bis 22. Oktober 2006 fand in Nürnberg der dritte Kongress „Medizin und Gewissen“ statt. Die rund 1.000 Teilnehmer*innen erlebten ein abwechslungsreiches Programm, das sich unter dem Titel „Zwischen Markt und Solidarität“ vor allem den Folgen der zunehmenden Ökonomisierung und Kommerzialisierung für das heutige Gesundheitswesen widmete. Aber auch medizinhistorische Themen fanden auf dem Nürnberger Kongress Raum. So berichteten herausragende Persönlichkeiten wie Alice Ricciardi von Platen und Hedy Epstein vom Nürnberger Ärzteprozess 1946/47. Robert Jay Lifton und Horst Eberhard Richter bereicherten den Kongress mit ihren Beiträgen und Erfahrungen. Für viele Teilnehmer*innen wurden die drei Tage in Nürnberg so zu einem intensiven Erlebnis.
Medizin und Gewissen 2001
Medizin und Gewissen – Wenn Würde ein Wert würde …

Der Zeitpunkt passte genau: Eine Woche nach der „Berliner Rede“ des Bundespräsidenten und eine Woche vor der spannungsvoll erwarteten Bundestagsdebatte zur Biomedizin begann in Erlangen der zweite IPPNW-Kongress „Medizin und Gewissen“ vom 24. bis 27. Mai 2001: Es wurde einer der bundesweit größten Medizinethik-Kongresse der letzten Jahre. Angesichts der Zuspitzung der Debatte um die Biomedizin gewann nicht zuletzt die Erlanger Rede der Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes besondere Bedeutung: Gerade in der Forschung könnten in Zukunft immer mehr biomedizinische Probleme vor Gerichten landen. Als Schirmherrin der Tagung sprach Jutta Limbach zum Thema „Menschenwürde, Menschenrechte und der Fortschritt der Medizin“. Drei Tage lang diskutierten und referierten 140 Vortragende in rund 60 Veranstaltungen mit knapp 1.500 Teilnehmer*innen. Dabei standen neben den aktuellen Themen der Biomedizin und Technologiefolgen ebenso Fragen der Menschenrechte und Gesundheitspolitik auf dem Programm.
Medizin und Gewissen 1996
Medizin und Gewissen – 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess

Nach vierjähriger Vorbereitungszeit veranstaltete die Nürnberger Regionalgruppe gemeinsam mit der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) vom 25. bis 27. Oktober 1996 den internationalen Kongress „Medizin und Gewissen – 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess“. An den 11 Plenarveranstaltungen und 64 Foren rund um die „Straße der Menschenrechte“ nahmen über 1.600 Besucher*innen, 150 Referent*innen und 100 Journalist*innen teil. Die Authentizität des Ortes, die Vielfalt der Themen und die große Zahl von Teilnehmer*innen unterschiedlicher Generationen und Professionen ließen eine ungewöhnliche Stimmung und Atmosphäre entstehen: eine Aufbruchstimmung gegen die restaurativen Tendenzen.
Kongressreihe "Tschernobyl und Fukushima"
In fünfjährigem Abstand findet zudem eine Kongressreihe der IPPNW zu den Folgen der atomaren Katastrophen statt. Bis 2011 erörterten internationale Expert*innen und Wissenschaftler*innen die Auswirkungen der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl auf Mensch und Umwelt. Einen Monat nach den drei Super-GAUs in Fukushima-Dai-ichi berichteten Referent*innen aus Japan zudem erstmals über die Situation in Japan. Bei den folgenden Kongressen standen die gravierenden Folgen der Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima auf die Menschen, die Natur und die Gesellschaft im Focus.
5 Jahre Fukushima - 30 Jahre Tschernobyl
Internationaler Kongress in Berlin 2016

Am 26. April 1986 fand die Mär von der "sicheren Atomkraft" mit dem Super-GAU von Tschernobyl ein abruptes Ende. Die radioaktive Wolke zog um die ganze Erde und machte Millionen von Menschen über Nacht zu Opfern. Viele starben und noch viel mehr leiden bis heute an den Folgen der Strahlung. Am 11. März 2011 zeigte sich, dass die Menschheit die Lektion von Tschernobyl nicht gelernt hatte, als es in Fukushima zu einem mehrfachen Super-GAU kam. Auch von dieser atomaren Katastrophe sind wieder Millionen Menschen betroffen. Anlässlich der beiden runden Jahrestage veranstaltete die IPPNW vom 26.-28. Februar 2016 einen internationalen Kongress zum Thema "5 Jahre Leben mit Fukushima - 30 Jahre Leben mit Tschernobyl" in der Urania in Berlin mit Expert*innen aus Japan, der ehemaligen Sowjetunition, Deutschland, Großbritannien und den USA.
Folgen von Atomkatastrophen für Mensch und Natur
Internationale Tagung 2014

Die Atomkatastrophen von Tschernobyl, Fukushima und anderen Orten haben gravierende Auswirkungen auf die Menschen, die Natur und die Gesellschaft. Über das jeweilige Ausmaß der Schäden gehen die Meinungen auseinander. Vertreter von UN-Organisationen wie die Internationale Atomenergie Behörde (IAEO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Wissenschaftliche Komitee der UN für die Folgen von Strahlen (UNSCEAR) behaupten, es bestünde keine Gefahr für die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung. Demgebenüber kommen die Untersuchungen von Ärzt*innen und anderen Wissenschaftler*innen, die von der Atom-Lobby unabhängig sind, zum Ergebnis, dass atomare Verstrahlung schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge hat. Auf der Tagung vom 4.-7. März 2014 befassten sich Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen aus Japan, Belarus, Deutschland, den USA, Frankreich und Großbritannien mit den Folgen der atomaren Niedrigstrahlung.
Zeitbombe Atomenergie: 25 Jahre Tschernobyl - Atomausstieg jetzt!
Internationale IPPNW-Kongress 2011

In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Strahlenschutz und den Physicians of Chernobyl veranstaltete die IPPNW vom 8.-10. April 2011 in der Berliner Urania den internationalen Kongress "25 Jahre Tschernobyl, Zeitbombe Atomenergie – Atomausstieg jetzt!" Die Folgen der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl und die Menschen, die unter der atomaren Verseuchung leiden, standen im Mittelpunkt des internationalen Kongresses. Wissenschaftler*innen aus der Ukraine, aus Russland und Weißrussland haben sich über viele Jahre mit den Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl befasst. Sie waren im Alltag direkt mit den betroffenen Menschen konfrontiert. Auf dem IPPNW-Kongress stellten sie bis dato noch unbekannte Forschungsergebnisse einer internationalen Öffentlichkeit vor. Die IPPNW-Ärztin Katsumi Furitsu aus Japan berichtete zudem über die Folgen der atomaren Katastrophe in Fukushima.
Zeitbombe Atomenergie - 20 Jahre Tschernobyl
Internationaler IPPNW-Kongress 2006

Samstag, 26. April 1986, 1 Uhr, 23 Minuten, 40 Sekunden. Der Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl explodiert. 180.000 Kilogramm hochradioaktives Material im Inneren des Reaktors. Das entspricht der Menge von 1000 Hiroshima-Bomben. Mindestens 200 verschiedene radioaktive Stoffe werden in die Atmosphäre katapultiert. Nach wie vor werden die Folgen des Unfalls verdrängt, vertuscht, verharmlost, bagatellisiert. 100tausende waren und sind betroffen: in der Ukraine, Belarus, Russland, Polen aber auch in West- und Nordeuropa. 20 Jahre nach Tschernobyl referierten über 70 Expert*innen aus Deutschland, Russland, der Ukraine, Frankreich, Belarus, den USA und der Schweiz vom 7.-9. April 2006 in Bonn über die Folgen von Tschernobyl, die Bedrohung des Lebens durch radioaktive Strahlung und Lösungen für eine Welt ohne atomare Bedrohung.
Atomwaffen & Atomenergie in einer instabilen Welt
Europäischer Kongress der IPPNW 2004

Auf dem europäischen IPPNW-Kongress "Atomwaffen & Atomenergie in einer instabilen Welt, Analysen und Auswege“ vom 7. bis 9. Mai 2004 in der Urania Berlin diskutierten 40 Referent*innen, Wissenschaftler*innen, Politiker*innen und eine interessierte Öffentlichkeit aktuelle Themen der Atomnutzung. Neben dem aktuellen Stand und weiteren Planungen bei Atomwaffen bzw. Atomkraftwerken wurde über die Strukturen, Hintergründe, Mechanismen, Interessengruppen und Verflechtungen informiert, die eine atomare Abrüstung bzw. einen tatsächlichen Ausstieg aus der Atomenergie verhindern und Auswege aufgezeigt.
Fachtagungen
Global Health Security: Nationale Sicherheit vor Menschenrechten?
Konferenz zur Globalen Gesundheitssicherheit am 20. Juli 2019

Auf der internationalen Konferenz zum Thema "Globale Gesundheitssicherheit in Zeiten des Neoliberalismus" von IPPNW, der Deutschen Plattform Gesundheit und der Charité am 20. Juli 2019 in Berlin warnten die Veranstalter vor einem angstbasierten Fokus auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten wie z.B. Ebola oder Zika. Dieser Ansatz sei nicht repräsentativ für die globale Belastung durch Krankheiten und verhindere in vielen Fällen eine Debatte über soziale, wirtschaftliche und politische Determinanten der Gesundheit. Diese Debatte wurde auf der Konferenz mit ca. 100 internationalen Teilnehmenden aus Medizin, Politik, Wissenschaft und NGOs begonnen.
Best Practice for Young Refugees
Internationale Fachkonferenz am 6. und 7. Juni 2015

Die Deutsche Sektion der IPPNW, die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ) und die Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin organisierten am 6. und 7. Juni 2015 in Berlin die internationale Fachkonferenz "Best Practice für Young Refugees" zur Einschätzung des Alters, Entwicklungsstandes und Hilfebedarfs von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF). Als Ergebnis der Konferenz veröffentlichten die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und die IPPNW eine Berliner Erklärung. Gemeinsam mit weiteren UnterstützerInnen fordern sie darin die Einhaltung der körperlichen und psychischen Unversehrtheit und die Wahrung der Menschenwürde der jungen Flüchtlinge bei allen Maßnahmen zur Alterseinschätzung.
Die gesundheitlichen Auswirkungen radioaktiver Strahlung beim Uranbergbau
Fachtagung in Gera/Ronneburg vom 19. bis 22. Juni 2014

Im Sommer 2014 veranstaltete die IPPNW in Ronneburg bei Gera eine Fachtagung zu der langen Geschichte des Uranabbaus in Deutschland und dem Fokus auf seine Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt. Zentraler Aspekt bei den Vorträgen und Diskussion waren die Gefahren ionisierender Strahlung. Das Tagungsprogramm beinhaltete Vorträge von ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen über die Gefahren des Urans und seiner Zerfallsprodukte. Dabei wurden sowohl die direkten gesundheitlichen Auswirkungen besprochen, als auch indirekte Auswirkungen (wie Folgen für das Grundwasser und Sozialstrukturen), die wiederum in engem Zusammenhang mit der Gesundheit der Menschen stehen.
Gefahren ionisierender Strahlung
Expertentreffen am 19. Oktober 2013 in Ulm

Am 19. Oktober 2013 fand auf Einladung der IPPNW in Ulm ein Expertentreffen von ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen aus der Strahlenbiologie, Epidemiologie, Statistik und Physik aus Deutschland und der Schweiz statt. Die TeilnehmerInnen diskutierten den aktuellen Wissensstand zu den Gefahren ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich. Sie kamen zu dem Schluss, dass es keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen Strahlung unwirksam wäre. Die Expertenrunde forderte eine Anpassung des Strahlenschutzes an den aktuellen Stand der Wissenschaft. Ionisierende Strahlung führt – auch im Niedrigdosisbereich – zu manifesten gesundheitlichen Schäden. Die Risikobewertung aufgrund statistischer Erhebungen an Atombombenüberlebenden von Hiroshima und Nagasaki als Referenzkollektiv sei überholt. Aus dem Treffen ging das IPPNW-Papier "Gefahren ionisierender Strahlung" hervor.
Trauma und Gewalt
IPPNW-Tagung am 22. November 2008

Am 22. November 2008 veranstaltete die IPPNW eine Tagung „Trauma und Gewalt – Heilberufler im Spannungsfeld zwischen Recht, Politik und Ethik“ in Berlin. Prof. Veli Lök aus Izmir zeigte den beeindruckenden Film „Iskenseye Tolerans - Null Toleranz gegen Folter" über die Arbeit der Menschenrechtsstiftung in der Türkei, in dem die lärmenden Bilder brutaler Polizeigewalt den sachlichen ruhigen Stellungnahmen der Menschenrechtler aus Izmir und Istanbul gegenüber gestellt werden. Der mit vielen türkischen und internationalen Preisen ausgezeichnete Professor für Orthopädie und klinische Traumatologie berichtete im Anschluss über die Menschenrechtsarbeit in der Türkei und die Geschichte der türkischen Menschenrechtsstiftung.
achten statt verachten
IPPNW-Tagung 19. Januar 2008

Die Tagungsteilnehmer*innen der IPPNW-Tagung "achten statt verachten" am 19. Januar 2008 waren sich einig: Der "Prüfauftrag Illegalität" der Großen Koalition von 2005 hat bisher zu keiner Verbesserung der Lebenssituation der Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland geführt. Zahlreiche praxisnahe Lösungsvorschläge von Wohlfahrtsverbänden, Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen, Kirchen, Ärzten und Menschen, die mit den Problemen dieser Menschen konfrontiert sind, blieben bisher unberücksichtigt.
Globalisierung, Krieg und Intervention
IPPNW-Tagung am 14./15. Januar 2006 in Frankfurt

Die IPPNW-Tagung am 14. und 15. Januar 2006 befasste sich mit der Fragestellung, inwiefern bei massiven Menschenrechtsverletzungen - bis hin zum Genozid - bei Versagen anderer Maßnahmen auf das letzte Mittel der militärischen Gewaltanwendung von außen zurückzugreifen ist. Die fortgeschreitende Transformation der Armee von einer zur Landesverteidigung hin zu einer Interventionsstreitmacht wird dies mit einem entgrenzten Sicherheitsbegriff begründet und zugleich mit dem Argument, die deutsche Verantwortung für globale Demokratie und Menschenrechte erfordere die Bereitschaft zu Militäreinsätzen überall in der Welt.
Folter und Humanität
Öffentliche Tagung der IPPNW 2004

Unter dem Eindruck der Folterskandale im Irak veranstaltete die IPPNW am 6. November 2004 eine Öffentliche Tagung "Folter und Humanität". Die Folterskandale müssten als Symptome einer unmittelbaren Gefährdung des internationalen Werte- und Rechtssystems, damit als verheerender Rückschlag für die Hoffnung auf einen fortschreitenden Zivilisierungsprozess begriffen werden, so IPPNW-Gründungsmitglied Horst-Eberhard Richter. Die Wiederauferstehung des Folter-Unwesens verlange eine schonungslose selbstkritische Auseinandersetzung mit einer der schlimmsten Formen der Gewaltbereitschaft. Die Aufarbeitung dürfe nicht bei den Ausführenden Halt machen, sondern müsse bei der menschenverachtenden Mentalität der hohen Verantwortlichen ansetzen, von denen sich die Täter inspiriert fühlten.
Materialien

Medizin und Gewissen
Im Streit zwischen Markt und Solidarität
Dokumentation zum 3. IPPNW-Kongress
Im IPPNW-Shop bestellen
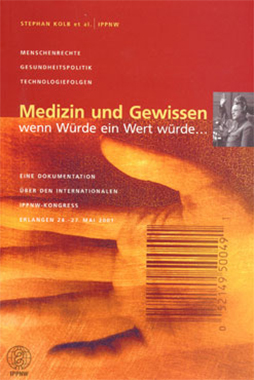
Medizin und Gewissen
Wenn Würde ein Wert würde ...
Dokumentation zum 2. IPPNW-Kongress
Im IPPNW-Shop bestellen
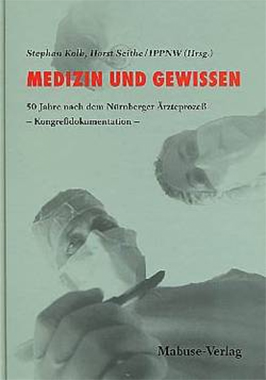
Medizin und Gewissen
50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess
Dokumentation zum 1. IPPNW-Kongress
Im IPPNW-Shop bestellen

IPPNW-Report
30 Jahre Leben mit Tschernobyl
5 Jahre Leben mit Fukushima
Im IPPNW-Shop bestellen
PDF-Download:
Deutsch | Englisch | Französisch
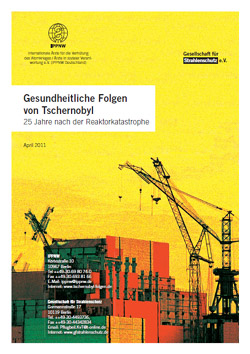
Gesundheitliche Folgen von Tschernobyl
25 Jahre nach der Reaktorkatastrophe
Studie, 2011
Im IPPNW-Shop bestellen

Kultur des Friedens
Aufstehen für die Menschlichkeit
Dokumentation zum IPPNW-Kongress 2003
Im IPPNW-Shop bestellen

Best Practice for Young Refugees
Ergebnisse und Beiträge der internationalen Fachkonferenz 2015
Im IPPNW-Shop bestellen